
Grauer Star
Share
Der Graue Star, medizinisch als Katarakt bezeichnet, ist eine der häufigsten Augenkrankheiten weltweit. Er tritt besonders bei älteren Menschen auf, kann jedoch auch jüngere betreffen. Die Erkrankung führt zu einer Trübung der Augenlinse, was das Sehvermögen erheblich beeinträchtigen kann. Ohne Behandlung kann der Graue Star sogar zur Erblindung führen.
Der Graue Star ist eine Trübung der natürlichen Augenlinse. Die Linse, normalerweise klar und transparent, bricht das Licht und fokussiert es auf die Netzhaut, um klare Bilder zu erzeugen. Bei einem Grauen Star wird die Linse jedoch undurchsichtig, was zu unscharfem Sehen, Lichtempfindlichkeit und einer Beeinträchtigung der Lebensqualität führen kann.
Die Erkrankung entwickelt sich oft langsam und schmerzfrei, weshalb sie zunächst unbemerkt bleibt. Der Graue Star ist die häufigste Ursache für reversible Blindheit weltweit.
Erfahre alles, was du über den Grauen Star wissen musst: von den Ursachen und Risikofaktoren über die Symptome und Diagnose bis hin zu modernen Behandlungsmethoden und Präventionsstrategien.
Ursachen und Risikofaktoren
Ursachen
Die Trübung der Linse beim Grauen Star entsteht durch Veränderungen in der Struktur der Linsenproteine. Diese Veränderungen können durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden:
- Alterung: Der häufigste Grund ist die natürliche Alterung, bei der die Linse mit der Zeit weniger flexibel und durchsichtig wird.
- Verletzungen: Verletzungen des Auges können die Linsenstruktur beschädigen.
- Krankheiten: Bestimmte Krankheiten wie Diabetes erhöhen das Risiko für einen Grauen Star.
- Erbkrankheiten: Einige Formen des Grauen Stars sind genetisch bedingt.
Risikofaktoren
Mehrere Faktoren können die Wahrscheinlichkeit eines Grauen Stars erhöhen:
- Alter: Das Risiko steigt ab dem 60. Lebensjahr deutlich an.
- UV-Strahlung: Übermäßige Sonneneinstrahlung ohne Schutz kann die Linse schädigen.
- Rauchen: Erhöht die Produktion freier Radikale, die die Linsenproteine schädigen.
- Alkoholkonsum: Übermäßiger Alkoholkonsum kann das Risiko erhöhen.
- Medikamente: Längere Einnahme von Kortikosteroiden ist ein bekannter Risikofaktor.
- Augenoperationen oder -entzündungen: Können die Entwicklung eines Grauen Stars beschleunigen.
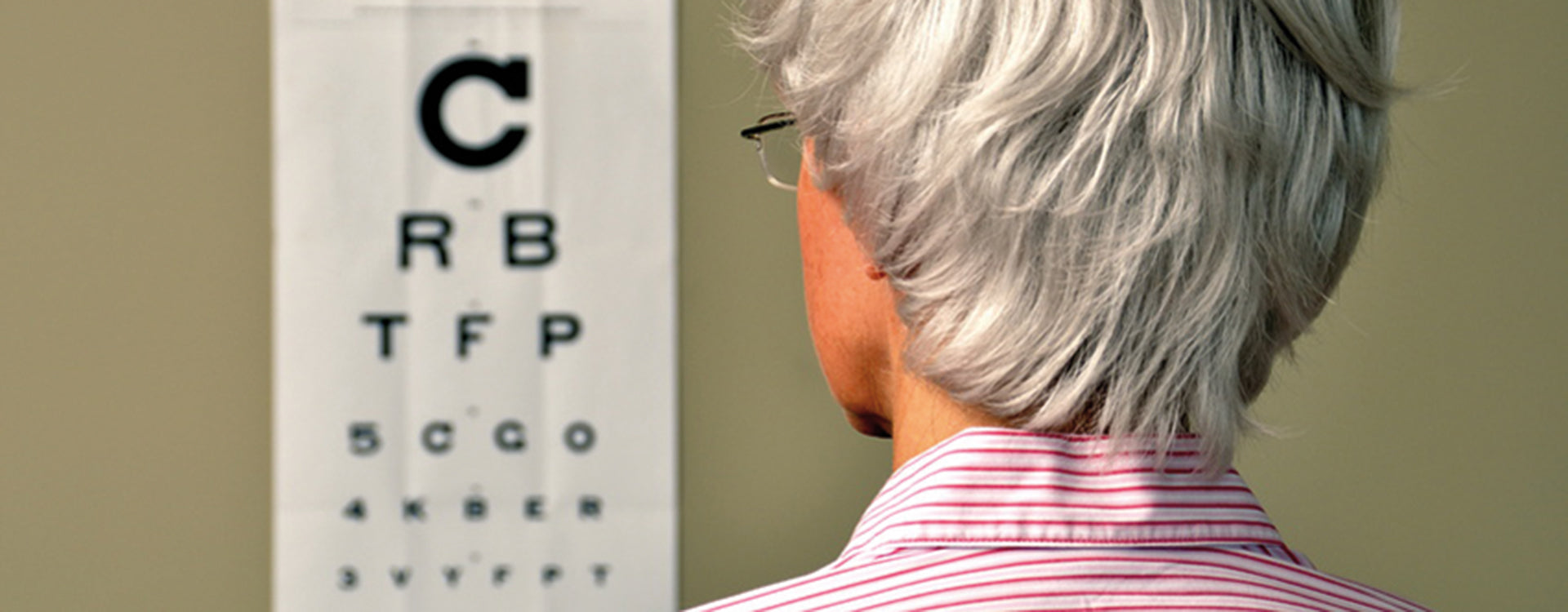
Symptome des Grauen Stars
Die Symptome des Grauen Stars entwickeln sich oft langsam und werden von Betroffenen nicht sofort wahrgenommen. Zu den häufigsten Anzeichen gehören:
- Verschwommenes Sehen: Bilder wirken unscharf oder wie durch einen Schleier gesehen.
- Lichtempfindlichkeit: Helles Licht oder Scheinwerfer können blenden.
- Schwierigkeiten bei Nacht: Nachtsichtprobleme und erhöhter Blendungseffekt durch Straßenlaternen oder Scheinwerfer.
- Doppeltsehen: In frühen Stadien kann es zu Doppeltsehen in einem Auge kommen.
- Farbveränderungen: Farben erscheinen weniger lebendig oder verfärbt.
- Häufige Wechsel der Brillenstärke: Betroffene benötigen häufiger neue Brillen oder Kontaktlinsen.

Arten des Grauen Stars
- Kernkatarakt: Trübung im Zentrum der Linse, oft altersbedingt.
- Rindenkatarakt: Trübung in der äußeren Schicht der Linse, häufig mit diabetischen Patienten assoziiert.
- Hinterer subkapsulärer Katarakt: Trübung im hinteren Teil der Linse, die schnell fortschreiten kann.
- Angeborener Katarakt: Erblich bedingt oder durch Infektionen während der Schwangerschaft verursacht.
Diagnose des Grauen Stars
- Anamnese: Symptome, Vorerkrankungen und Lebensgewohnheiten.
- Sehtest: Überprüfung der Sehschärfe.
- Spaltlampenuntersuchung: Beurteilung der Linse und anderer Augenstrukturen.
- Ophthalmoskopie: Untersuchung der Netzhaut und des Augenhintergrunds.
- Tonometrie: Messung des Augeninnendrucks, um andere Erkrankungen auszuschließen.

Behandlungsmöglichkeiten
Der Graue Star kann nicht durch Medikamente oder Brillen beseitigt werden. Die einzige wirksame Behandlung ist eine Operation, bei der die trübe Linse entfernt und durch eine künstliche Linse ersetzt wird.
Wann ist eine Operation notwendig?
Eine Operation wird empfohlen, wenn:
- der Graue Star die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt,
- Aktivitäten wie Lesen, Autofahren oder Arbeiten stark eingeschränkt sind,
- andere Augenerkrankungen durch die Trübung der Linse verschlechtert werden.
Arten der Kataraktoperation
Die Kataraktoperation ist eine der sichersten und am häufigsten durchgeführten Operationen weltweit. Es gibt zwei Hauptmethoden:
- Phakoemulsifikation: Ultraschallenergie zerkleinert die trübe Linse, die abgesaugt wird; anschließend wird eine künstliche Linse eingesetzt.
- Extrakapsuläre Kataraktextraktion: Die Linse wird im Stück entfernt – bei sehr fortgeschrittenem Grauen Star.
Künstliche Linsen (Intraokularlinsen)
- Monofokallinsen: Scharfes Sehen in einer Entfernung (z. B. Ferne).
- Multifokallinsen: Scharfes Sehen in mehreren Entfernungen.
- Torische Linsen: Korrigieren zusätzlich eine Hornhautverkrümmung.
Prävention des Grauen Stars
Es gibt keine garantierte Möglichkeit, den Grauen Star zu verhindern, aber einige Maßnahmen können helfen, das Risiko zu reduzieren:
- UV-Schutz: Sonnenbrille mit UV-Schutz tragen.
- Raucherentwöhnung: Rauchen vermeiden, um freie Radikale zu reduzieren.
- Gesunde Ernährung: Antioxidantien wie Vitamin C/E sowie Lutein und Zeaxanthin.
- Regelmäßige Augenuntersuchungen: Besonders ab 40 Jahren.
- Krankheiten kontrollieren: z. B. Diabetes gut einstellen.
- Schutz vor Augenverletzungen: Schutzbrillen bei riskanten Aktivitäten.

Leben mit dem Grauen Star
Für Menschen mit Grauem Star ist es wichtig, sich der Erkrankung bewusst zu sein und frühzeitig ärztliche Hilfe zu suchen. Mit der heutigen Medizin können die meisten Fälle erfolgreich behandelt werden – die Lebensqualität steigt deutlich.
Fazit
Der Graue Star ist weit verbreitet, aber gut behandelbar. Eine frühzeitige Diagnose und die Kataraktoperation können das Sehvermögen wiederherstellen. Mit UV-Schutz, gesunder Ernährung und regelmäßigen Kontrollen lässt sich das Risiko zusätzlich senken. Bei Verdacht: unbedingt augenärztlich abklären lassen.